Zehengelenksarthrose beim Hund – wenn die Pfoten bei jedem Schritt schmerzen
18. Februar 2020
16 Kommentare
Wenn ein Hund unter Arthrose in den Zehen – also unter einer Zehengelenksarthrose – leidet, wird das meist kleingeredet und verharmlost. Das ist ja nur ...
Weiterlesen →
4 Tipps damit ein Hund mit Gelenkproblemen schnell wieder fit wird & was du vermeiden solltest!
28. Mai 2019
Ein Kommentar
Gelenkprobleme beim Hund sind ein Thema, was fast jeden Hundehalter im Laufe eines Hundelebens trifft. Immer wieder fragen mich dann Hundehalter nach Tipps, wie sie ...
Weiterlesen →
Radfahren mit Hund – diese Dinge solltest du wissen!
29. Januar 2019
Keine Kommentare
Besonders im Frühjahr und Sommer ist das Radfahren mit dem Hund eine beliebte sportliche Aktivität. Wenn es richtig gemacht wird, ist es ein tolles Training ...
Weiterlesen →
Knochenkrebs beim Hund – alle Fakten zur Erkrankung
15. Januar 2019
Ein Kommentar
Knochenkrebs ist eine häufige Krebserkrankung beim Hund. Man muss nicht drum herum reden, dass die Prognose äußerst schlecht ist. Dennoch ist es eine Erkrankung, mit ...
Weiterlesen →
Ursachen für Übergewicht beim Hund – so wird dein Hund dick!
23. Juli 2018
3 Kommentare
Übergewicht ist ein ernstes Gesundheitsrisiko. Ursachen für Übergewicht beim Hund – da gibt es auf jeden Fall verschiedene. Und dabei meine ich nicht: „Das ist ...
Weiterlesen →
Ist das Gewicht deines Hundes optimal? So erkennst du, ob dein Hund zu dick ist!
23. Juli 2018
Ein Kommentar
ist dein Hund übergewichtig? Damit wäre er zumindest nicht alleine, denn fast jeder zweite Hund ist heutzutage leider übergewichtig. Tendenz steigend: immer mehr Hunde leiden ...
Weiterlesen →
Dein Hund schwimmt nicht gern oder darf es nicht? – Wassertreten für Hunde – die Alternative
11. Juli 2018
Ein Kommentar
Wassertreten für Hunde wird immer populärer. Aber warum eigentlich? Hunde können doch schwimmen, oder? Außerdem hört es sich sterbenslangweilig an. Doch es gibt sie, die ...
Weiterlesen →
Schwimmen mit Hund – diese 10 Punkte solltest du beachten!
4. Juli 2018
4 Kommentare
Schwimmen mit Hund ist eine beliebte Aktivität in den heißen Sommermonaten. Viele Hunde lieben es im kühlen Nass zu schwimmen und zu toben. Eine willkommene ...
Weiterlesen →
4 hilfreiche Tipps um Gelenkprobleme beim Hund vorzubeugen – Teil I
10. Januar 2018
Ein Kommentar
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Gelenkprobleme beim Hund vorzubeugen? Auf jeden Fall! Doch selbst wenn dein Vierbeiner bereits unter einer Gelenkerkrankung leidet, kannst du die folgenden ...
Weiterlesen →
Physiotherapie beim Hund – so vielseitig kann sie eingesetzt werden!
9. August 2017
6 Kommentare
Ich nehme es gleich vorweg: Physiotherapie beim Hund ist tatsächlich für “Jederhund“ empfehlenswert. Punkt. Völlig grundlos gibt es immer noch Stimmen, die Physiotherapie beim Hund belächeln. ...
Weiterlesen →
Degility – gesunder und cooler Sport für deinen Hund!
9. Mai 2017
6 Kommentare
Beim Thema Degility schlägt mein Physiotherapeuten-Herz höher. Warum? Weil ich nicht müde werde zu wiederholen, wie wichtig aktive Bewegung für Hunde jeden Alters ist. Ganz ...
Weiterlesen →
Rückenschmerzen beim Hund – so erkennst du sie!
16. März 2017
11 Kommentare
Rückenschmerzen beim Hund sind keine Ausnahme! Wer denkt, dass Rückenschmerzen beim Hund eine Ausnahmeerscheinung ist, der hat weit gefehlt. Viel mehr Vierbeiner sind betroffen, als ...
Weiterlesen →
So erkennst du Übergewicht beim Hund und verhinderst, dass er krank wird
13. Oktober 2016
7 Kommentare
Du bist unsicher, ob dein Hund unter Übergewicht leidet? Übergewicht ist ein heikles Thema. Oftmals fällt es uns schwer einzuschätzen, ob unser Hund betroffen ist. ...
Weiterlesen →
Wie wird dein Hund dick? – die fatalen Folgen von Übergewicht beim Hund
6. Oktober 2016
7 Kommentare
Übergewicht ist ein ernstes Gesundheitsrisiko Übergewicht Hund Niemand hört gerne, sein Hund sei zu dick. Übergewicht ist ein heikles Thema, was sich viele nicht trauen ...
Weiterlesen →






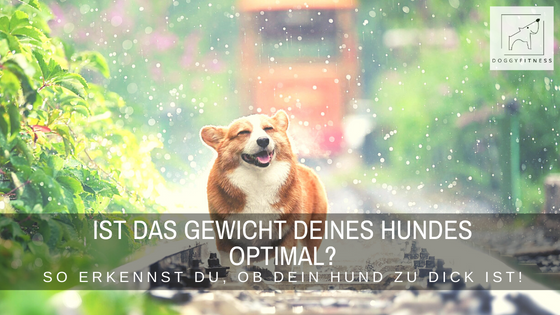



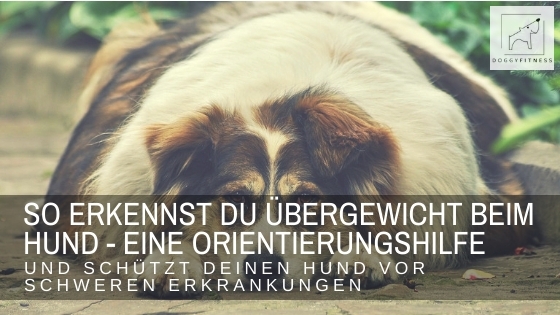


Neueste Kommentare